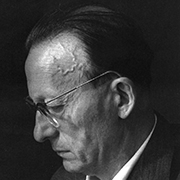Miloslav Kabeláč gehört zu den bedeutendsten tschechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Man kann ihn bedenkenlos als den größten Symphoniker der Generation nach Bohuslav Martinů bezeichnen.
Das Rückgrat des kompositorischen Werkes von Miloslav Kabeláč (1908–1979) bildet die monumentale Reihe von acht Symphonien. Dazu kommen weitere Orchesterwerke aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Mysterium času (Mysterium der Zeit, 1957), Hamletovská improvizace (Hamlet-Improvisation, 1963), Zrcadlení (Spiegelungen, 1968).
Für die Laufbahn eines erfolgreichen Symphonikers war Kabeláč ideal prädestiniert: Seine kreative Poetik weist eine Tendenz zu einer inhaltlichen Ernsthaftigkeit, zu monumentalen bzw. monumentalisierenden Aufbau- und Gedankenproportionen auf. Darüber hinaus folgt seine Kompositionsmethode stets einer detailliert durchdachte Architektur. Sie zeigt Sparsamkeit in der Arbeit mit musikalischen Ausdrucksmitteln und die Suche nach neuen Kompositionsweisen sowohl über Experimente als auch über eine Aktualisierung musikalischer Mittel und Kompositionstechniken, die von der europäischen Musik vernachlässigt wurden: Elemente außereuropäischer Musikkulturen.
Am Beginn der vierziger Jahre gelangte Kabeláč zu einer Stabilisierung der grundlegenden Parameter seiner musikalischen Sprache durch ihre Verankerung in einer modern aufgefassten Modalität, ähnlich wie beispielsweise Bartók, Messiaen, später auch Lutosławski, mit dem Kabeláč in freundschaftlichem Kontakt stand. Er schuf sich ein System modaler Strukturen, die er als „künstliche Tongeschlechter“ bezeichnete und mit denen er bis zum Ende seines Lebens konsequent arbeitete. Ein weiteres charakteristisches Merkmal seines schöpferischen Ausdrucks ist das Bemühen um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen spontaner intuitiver Kreativität und rationaler Überlegung. Kabeláč war eine allseits gebildete Persönlichkeit mit einem theoretischen, historischen und ethnomusikologischen Überblick. Außerdem verfügte er über bemerkenswerte mathematische und technische Kenntnisse. Kabeláč‘ musikalische Sprache ist im weitesten Sinne des Wortes modal: Der Komponist nutzt auf verschiedenartige Weise organisierte Tonreihen, die er nicht nur als melodisches und akkordisches Material verwendet, sondern er wendet die von hier abgeleiteten Ziffernbeziehungen auch auf andere Parameter der musikalischen Sprache an – auf Parameter der Rhythmometrik, der Klangfarbe, aber auch der Form.
Kabeláč hat nie völlig die Tonalität verlassen, wenngleich es sich um eine sehr breit gefasste Tonalität handelt. Seine Melodik ist sehr sparsam, sie nutzt vor allem Sekundschritte, höchstens noch kleine Terzen. Die aktualisierten Techniken der Heterophonie und der frühen Mehrstimmigkeit sind in seinem Schaffen ähnlich vertreten wie raffinierte Vorgehensweisen in der Polyphonie der Renaissance einschließlich unterschiedlicher Inversions-, Spiegelungs-, Augmentations- und Diminutionsmethoden. Als erster tschechischer Komponist überhaupt setzte Kabeláč in seinem Schaffen auch Elemente aus der indischen und der japanischen Musik ein, gleichzeitig aber auch z. B. der Musik polynesischer Kulturgebiete. In seinen späten Symphonien arbeitet Kabeláč sehr ungewöhnlich auch mit einem Bibeltext. Die Symphonie Nr. 8 „Antifony“ (1969–70) stellt den Höhepunkt der innovativen Vorgehensweisen Kabeláč´ im Rahmen des traditionellen Genres der Symphonie dar: Sie besteht aus neun Teilen – fünf Sätze sind durch vier Intermedien verbunden, für die Aufführung vorgeschrieben sind eine große Schlagzeuggruppe, Orgel, großer gemischter Chor und ein Koloratursopran.
Jaromír Havlík
(Übersetzung: Silke Klein)
„Das Werk von Miloslav Kabeláč stellt für mich fast seit meiner Kindheit ein Ideal dar, und zwar mit aller Ernsthaftigkeit, die einen Musiker der Moderne ausmacht. Es ist ein kleines großes Wunder: Kabeláč biedert sich nie an und reißt doch ständig mit, begeistert und dringt in die Tiefe der menschlichen Seele ein. Ich liebe an ihm seine Reinheit des Stils und den Mut, unter allen Umständen einer eigenwilligen, jedoch universell verständlichen kompositorischen Konzeption treu zu bleiben, die er für sich selbst festgelegt hat, ungeachtet einer Modelaune oder eines Windstoßes der Zeit. Kabeláč ist für mich im künstlerischen Sinne eine moralische Autorität.“
Jakub Hrůša
aus: [t]akte 2/2015