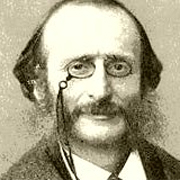Die Neuausgabe von Offenbachs Operette geht erstmals auf die autographe Partitur zurück. Nun folgen in Bielefeld und Biel in kurzem Abstand zwei Neuinszenierungen mit der 2000 erstmals verwendeten Edition.
La Belle Hélène (Uraufführung: Paris, Théâtre des Variétés, 17. Dezember 1864) ist ein Schlüsselwerk innerhalb der Werke Offenbachs und für die Gattung Operette insgesamt. Die deutschsprachige Erstaufführung (Wien, Theater an der Wien, 17. März 1865) gab den endgültigen Anstoß zur Entwicklung der Wiener Operette von Suppé, Johann Strauss und Millöcker. Für das Libretto der hat Offenbach erstmals Ludovic Halévy und Henri Meilhac als Autoren zusammengebracht. Damit war die womöglich erfolgreichste und brillanteste Autorengemeinschaft des französischen Sprech- und Musiktheaters in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet.
Die kritische Neuausgabe der Belle Hélène ist die erste Ausgabe einer der großen Offenbach-Operetten, die den Notentext einer sorgfältigen philologischen Prüfung unterzieht. Sie geht erstmals auf die autographe Partitur Offenbachs zurück, die nahezu vollständig erhalten ist. Das Ergebnis der kritischen Sichtung weicht erheblich von der bisher bekannten und vertrauten Werkgestalt ab. Dies betrifft insbesondere die Instrumentation und die Faktur der einzelnen Nummern.
Offenbachs Konzession für die Bouffes-Parisiens erlaubte nur einen stark reduzierten Orchesterapparat, was ihn nahezu zu einer Halbierung des Bläsersatzes zwang. In der Belle Hélène konnte er auf immerhin 24 Musiker zurückgreifen. Der Orchestersatz ist ausgesprochen durchsichtig angelegt, aber so virtuos und der musikalisch-dramaturgischen Situation angemessen, dass die beschränkte Anzahl der Spieler nirgendwo als Manko empfunden wird. Jedes Instrument ist optimal eingesetzt. Die Neuausgabe gibt erstmals die Möglichkeit, den Orchestersatz so aufzuführen, wie Offenbach ihn formuliert hat.
Die Auswertung der autographen Partitur macht deutlich, dass die Gérard-Ausgabe von 1865 ebenso wenig das enthält, was bei der Uraufführung aufgeführt wurde, wie die Bote & Bock-Ausgabe (gleichfalls 1865) das, was bei der Wiener Erstaufführung gespielt wurde. Die auffälligste Abweichung betrifft das Zentrum des zweiten Aktes, das „Jeu de l´oie“ (Gänsespiel). In dieser Szene haben die Autoren die fragwürdige Korruptheit der Oberschicht im antiken Sparta satirisch auf den Punkt gebracht. Kalchas, Großaugur des Jupiter und gegen Geldzuweisungen manipulierbarer und manipulierender Politiker, will den Pott des Gänsespiels knacken, der durch Spieleinsätze prächtig gefüllt ist. Dies ist nur durch die Verwendung gezinkter Würfel möglich. Offenbach und seine Librettisten zeigen diese Manipulation in einem umfangreichen Ensemble in aller Offenheit. Vom Nimbus eines staatstragenden Auguren bleibt nichts mehr übrig. Parallelen zur politischen Situation im Kaiserreich unter Napoleon III. sind ganz offensichtlich. Vor der Uraufführung wurde die erste Hälfte diese Ensembles gestrichen, in dem die Manipulation des Glücksspiels gezeigt wird. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass damit einem Eingriff der Zensur zuvorgekommen werden sollte.
Auch das Ende der Belle Hélène erscheint in neuem Licht. Aus den Quellen ist ersichtlich, dass zu diesem Finale mindestens acht Versionen existieren. Drei dieser Versionen sind in der autographen Partitur vollständig dokumentiert und werden in der Neuausgabe vorgelegt. Nur eine der Finalversionen endet mit dem frivolen Happy End der Gérard-Ausgabe, bei dem die zurückbleibenden düpierten Griechen Paris und Helena heiter verabschieden. Alle anderen Versionen enden mit einer Kriegserklärung der Griechen an die Trojaner, ein Ausgang, der dem antiken Mythos korrekt folgt: der Raub der Helena durch Paris ist der Auslöser des Trojanischen Krieges. Im Mythos wie in der französischen Oper schließen sich daran an die beiden Iphigenien von Christoph Willibald Gluck und Les Troyens von Hector Berlioz. Offenbachs Belle Hélène ist das Satyrspiel zu diesem musiktheatralischen Antikenprojekt, das die Grundlage der musikalischen Tragödien als Operette nachliefert.
Robert Didion †
aus [t]akte 1/2000