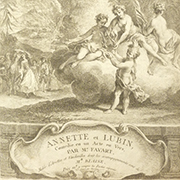Nach der Uraufführung von 1762 war die Oper Annette et Lubin eine europaweite Berühmtheit. Nun bietet die Edition aus dem Projekt OPERA die Gelegenheit, dieses Werk wiederzuentdecken.
Uraufgeführt am 15. Februar 1762, stand die Opéra comique Annette et Lubin von Justine Favart und Adolphe Blaise mehrere Wochen ununterbrochen auf dem Pariser Spielplan, wurde sehr positiv besprochen und erschien in rascher Folge in zahlreichen Druckausgaben. In ganz Europa wurde das Stück nachgespielt oder bearbeitet. Annette et Lubin kann als ein Schlüsseltext des Musiktheaters der Aufklärung gelten – ein Stück, das in intelligenter und geradezu raffinierter Weise zentrale moralphilosophische und gesellschaftspolitische Themen behandelt.
Marie-Justine-Benoîte Favart (1727–1772, geb. Duronceray) war eine berühmte Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin und auch eine hervorragende Autorin. Mit Annette et Lubin bezog sie sich auf die gleichnamige Erzählung von Jean-François Marmontel. Das Schauspiel beruht somit musikalisch sowohl auf neukomponierten Nummern und Ensembles (aus der Feder des Fagottisten und Orchesterleiters Adolphe Benoît Blaise, ca. 1720–1772) als auch auf bekannten Lied- und Opernmelodien.
Die Stücke Justine Favarts (am bekanntesten Les amours de Bastien et Bastienne, 1753) behandeln das Thema der von finanziellem oder ständischem Kalkül freien „natürlichen Liebe“, die durch mächtige und reiche Konkurrenten bedroht wird. In Marmontels Erzählung werden Lubin und seine Cousine Annette von einem Landvogt wegen ihrer Liebe scharf verurteilt. Annette erwartet ein uneheliches Kind, was dem Vogt Gelegenheit zu einem Erpressungsversuch verschafft: Nur eine Heirat mit ihm könne Annette vor der Verdammung durch Gesellschaft und Kirche retten. Annette und Lubin gewinnen jedoch die Gunst des Grafen, der ihre Heirat ermöglicht. Für die Bühne hat Favart die Motive der Blutsverwandtschaft und der Schwangerschaft sowie den kirchlichen Bezug eliminiert und im Gegenzug Lubins Mut wirkungsvoll dramatisiert, der todesmutig auf den Bailli und den Seigneur losgeht. Mit solchen Eingriffen erreicht sie eine fundamentale Umdeutung der Quintessenz: Während Marmontel seine Leserinnen vor naivem Vertrauen auf „die einfachen Gesetze der Natur“ – sprich: vor unstatthaften Liebesbeziehungen – warnen will, gerät die Bühnenfassung zu einer vorbehaltlosen Apotheose der natürlichen, wahren Liebe.
Neukomposition und Zitat gehen sowohl im Dienste des Ausdrucks wie zur bisweilen doppelbödigen Inhaltsvermittlung eine bemerkenswerte Verbindung ein. So klagt Annette in einer rührenden Soloszene: „Pauvre Annette / Quelle douleur secrète / me frappe et m’inquiète“. Die Musik dieser Nummer ist eine italienische Opera-seria-Arie aus Johann Adolf Hasses Adriano in Siria. Wie schon die Ouvertüre (eine bis dato völlig unbekannte Sinfonia von Johann Joachim Christoph Bode im „empfindsamen Stil“) steht dieses Bravourstück der Annette in g-Moll und etabliert einen bis dahin in der Gattung ungekannt ernsthaften Ton. Die über die vielen Zitate aufgerufenen Kontexte reichen weit über das Bühnengeschehen hinaus und rufen philosophische Kategorien wie den Gegensatz Natur/Kultur auf, um letztlich – im Nachgang des Buffonistenstreits – den ästhetischen Abstand der französischen Operntradition von der „natürlichen“ Musiksprache der „unverbildeten“ Landkinder präzise zu vermessen.
Die günstige Quellenlage lässt es zu, die Edition auch für die Vaudevilles als vollständige Orchesterpartitur anzulegen – ein Glücksfall, wenn man bedenkt, dass bei vergleichbaren Opéras comiques oft nur Melodien, aber kein Orchestersatz überliefert sind. Die historisch-kritische Edition umfasst den Text gleichermaßen und wird so den für die Gattung charakteristischen Wechsel von Musik und Dialog hervortreten lassen. Im elektronischen Teil (Edirom) werden neben den eigentlichen Werk-Quellen auch – ein Novum in der Editionsgeschichte der frühen Opéra comique – die über Melodie- und Textzitate in Annette et Lubin präsenten Sub- und Kontexte umfassend dokumentiert.
Andreas Münzmay
(aus [t]akte 1/2014)